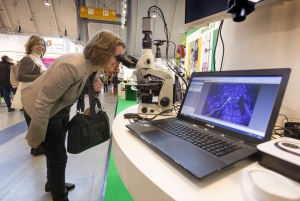Von Andrej Priboschek
Keine Frage: Die Inklusion in der Schule ist ein Reizthema. In die – berechtigten – Debatten um unzureichende Bedingungen oder die konkrete Ausgestaltung mischen sich in jüngster Zeit allerdings immer öfter Forderungen, die Inklusion (wie G8) komplett zurückzudrehen. Mal abgesehen davon, dass sich Deutschland zur Inklusion international verpflichtet hat (anders als zu G8): Der gemeinsame Unterricht ist eine großartige Errungenschaft. Daran sei anlässlich des Tags der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember erinnert.

Die Inklusion bringt behinderte und nicht-behinderte Kinder zusammen. Foto: Shutterstock
Dass eine Schulleiterin ihre oberste Dienstherrin – in diesem Fall: die Bremer Bildungssenatorin Claudia Bogedan, SPD – verklagt, war bundesweit ein Novum. Der Gegenstand des Streits in dieser Form auch: Die Direktorin zog vor Gericht, weil sie von der Bildungsverwaltung angewiesen wurde, Kinder mit Förderstatus aufzunehmen. Das Gymnasium wollte also richterlich klären lassen, ob es zur Inklusion verpflichtet ist – einem Staatsziel, zu dem sich die Bundesrepublik Deutschland seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 bekennt. Zu einem echten Grundsatzurteil kam es nicht. Das Verwaltungsgericht Bremen wies die Klage vordergründig aus dem formalen Grund zurück, dass eine Beamtin in dieser Causa schlicht nicht klagebefugt sei. Gleichwohl machten die Richter unmissverständlich klar, welchen Stellenwert die Inklusion in Deutschland rechtlich hat.
Die Einführung der inklusiven Beschulung an allen Schulen entspreche einem klaren gesetzgeberischen Auftrag, so führten die Richter aus. Und den habe auch das Bremer Gymnasium zu erfüllen. Entgegen der Ansicht der Klägerin werde durch die Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf weder eine „Schule für alle“ geschaffen, noch der gymnasiale Bildungsgang in seiner grundlegenden Konzeption verändert. Schlechtere Bildungschancen der Regelschüler seien durch die Inklusion nicht zu befürchten. Die Inklusionsschüler könnten durchaus „auf einem ihren jeweiligen Möglichkeiten entsprechenden Anforderungsniveau unterrichtet und gefördert“ werden. Fazit des Gerichts: „Schließlich erscheint es nicht fernliegend, sich den Herausforderungen der zieldifferenten inklusiven Beschulung (…) auch an Gymnasien zu stellen.“
Die Antwort der Richter ist eindeutig
Das Urteil vom 9. Juli sorgte unter vielen Lehrern für Empörung, waren die Richter doch scheinbar recht salopp über die unzureichenden Bedingungen hinweggegangen, unter denen schulische Inklusion in der Praxis allzu oft stattfindet. Bei dem Ärger über die richterliche Ansage wurde allerdings übersehen, dass es sich dabei um eine rein juristische Argumentation handelt – und nicht um die zweifellos zentrale praktische Frage, welche Ressourcen nötig sind, um die Inklusion erfolgreich gestalten zu können (und ob es diese vor Ort gibt). Aber die hatte die Schulleiterin ja auch nicht vorgebracht. Ihr ging es um das Prinzip, ob auch das Gymnasium zur Inklusion verpflichtet werden kann. Die Antwort der Richter ist eindeutig: Ja.
Der beispiellose Streit vor Gericht und die Reaktionen darauf machen anschaulich, dass es beim gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht-behinderten Kindern und Jugendlichen in Deutschland an weitaus mehr hapert als an einer ausreichenden Zahl von Lehrerstellen. Es fehlt an Verständnis. Allzu vielen Menschen hierzulande ist nicht klar, welche Bedeutung die Inklusion für die Schulen, für unsere gesamte Gesellschaft hat.
Das beginnt mit einer verklärenden Sicht auf die Vergangenheit: Das frühere Förderschulsystem mit gesonderten Gebäuden und überdurchschnittlich viel Personal sei doch gut gewesen, so ist immer wieder zu hören. Nein, das war es nicht! Hundertausende von Kindern und Jugendlichen wurden im Lauf der Jahrzehnte mit dem Förderschulstatus abgestempelt. Auch die, die objektiv zu Unrecht als „lernbehindert“ aussortiert wurden, bekamen aufgrund jahrelanger Unterforderung im isolierten Umfeld faktisch keine Chance mehr auf einen regulären Schulabschluss. Die damalige Rückschulungsquote ins Regelsystem nahe null belegt das. Der vermeintliche Schonraum wurde zur Falle.
Allein die Tatsache, dass die Exklusionsquote zwischen den Bundesländern erheblich variierte (im Schuljahr 2013/14 mit 1,9 Prozent in Bremen und 6,9 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern um mehr als das Dreifache) zeigt, wie willkürlich Kinder dabei ausgesondert wurden. Ein anschauliches Beispiel, wie das geschehen konnte, lieferte der Prozess um den ehemaligen Förderschüler Nenad, der das Land Nordrhein-Westfalen aufgrund seiner zerstörten Bildungskarriere verklagte – und Recht bekam (News4teachers berichtete).
Zweiter Punkt: Die Schule ist praktisch der einzige Ort, an dem alle Kinder zusammenkommen – hier (und nur hier) kann soziales Lernen in einer größeren Gemeinschaft stattfinden. Schon die Vorstellung, dass Schüler homogene Lerngruppen brauchen, um sich erfolgreich Wissen und Fachkompetenzen aneignen zu können, ist falsch, wie die Arbeit der Grundschulen in Deutschland tagtäglich belegt.
Das Dogma der möglichst großen Homogenität der Klassen wird in Bezug auf das soziale Lernen geradezu absurd. Wie sollen Kinder lernen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Voraussetzungen, Interessen und Perspektiven umzugehen, wie sollen sie lernen, sich in eine Gemeinschaft unterschiedlicher Individuen einzufügen, wie sollen sie lernen, für sich und andere, auch Schwächere, Verantwortung zu übernehmen – wenn sie nur von Gleichen umgeben sind? Hier bietet die Inklusion die Chance zur Begegnung auf Augenhöhe.
Wie wichtig diese Begegnungen für Kinder sind, sagen sie selbst. Die große Mehrheit (94 Prozent) fände es „gut“ oder „normal“, wenn Kinder mit Behinderung überall dabei wären – also auch in der Schule, wie eine aktuelle Umfrage der Aktion Mensch unter Schülerinnen und Schülern ergab. Fast zwei Drittel der befragten Mädchen und Jungen sehen Inklusion als Möglichkeit, dass sich Kinder mit und ohne Behinderung gegenseitig helfen könnten. Dass überhaupt Begegnungen stattfinden, dafür sorgt vor allem der gemeinsame Unterricht: Treffen zwischen Kindern mit und ohne Behinderung kommen überwiegend in der Schule zustande (77 Prozent) und nur selten in der Freizeit (18 Prozent), wie die Kinder berichten.
Heißt: Die Inklusion ist nichts Geringeres als eine Grundlage für eine soziale Gesellschaft, in der Kinder für mehr als ihren Eigennutz erzogen werden. Sie ist ein Menschenrecht, reicht in ihrer Wirkung aber weit über die Belange des oder der einzelnen Betroffenen hinaus. Das sollte am Tag der Menschen mit Behinderungen mal wieder deutlich gemacht werden. Auf dieser Grundlage lässt sich dann auch sinnvoll über die konkrete Ausgestaltung der Inklusion streiten – ob Förderschulen als freiwilliges Angebot erhalten werden sollten zum Beispiel, ob geistig Behinderte wirklich gut an einem Gymnasium aufgehoben sind, oder eben wie die Bedingungen aussehen müssen, um an Regelschulen erfolgreich inklusive Klassen unterrichten zu können. Es geht nicht um das Ob. Es geht ums Wie.