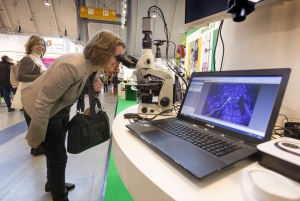Von Andrej Priboschek
Der Fall Mesut Özil ist ein Paradebeispiel für eine völlig missratene Krisenkommunikation. Daraus lassen sich Schlüsse ziehen für alle, die sich plötzlich einer empörten Öffentlichkeit gegenüber sehen. Das können, um im Bereich Bildung zu bleiben, Kultusminister sein. Oder Schulleitungen.

MIt diesem Twitter-Post informierte die AKP über das Treffen der Fußballer mit Erdogan. Screenshot
Der Rücktritt von Mesut Özil und das mediale Drumherum sollten für jeden Verantwortlichen in der Öffentlichkeitsarbeit und PR als Anschauungsbeispiel dienen. Überschrift: Was man auf jeden Fall vermeiden sollte, um im Krisenfall nicht noch Öl ins Feuer zu gießen. Der Anlass – das Wahlkampf-Foto mit dem türkischen Autokraten Erdogan – war zwar kritikwürdig, lag auf der nach oben offenen Skandalskala aber zunächst längst nicht im Katastrophenbereich. Zur Erinnerung: Özil war ja nicht der einzige Fußball-Nationalspieler, der sich für Erdogan einspannen ließ. Sein Mannschaftskollege Ilkay Gündogan war ja gleichermaßen aktiv. Mehr noch. Gündogan schenkte dem türkischen Staatsoberhaupt sogar ein Trikot mit der Widmung „Meinem Präsidenten“. Für einen Deutschen, Gündogan besitzt keinen weiteren Pass, eine bemerkenswert schräge Aussage.
Und trotzdem: Gündogan ist nach wie vor Nationalspieler – und kaum jemand hat seinen Beitrag zu dieser Affäre noch auf dem Schirm. Niemand verlangt seinen Rücktritt. Dabei hat er sich genauso wenig für die Wahlkampfhilfe entschuldigt wie Özil. Er hat auch nicht besser bei der Fußball-WM gespielt. Der entscheidende Unterschied: Gündogan hat sich rechtzeitig erklärt. Er hatte offenbar deutlich bessere PR-Berater als Özil.
Der größte Fehler, den Menschen machen können, die von den Medien mit einem negativen Ereignis verbunden werden und die sich deshalb plötzlich einer empörten Öffentlichkeit gegenübersehen, ist: abzutauchen. Den Reflex hat wohl jeder. Warum soll man sich öffentlich äußern, wenn der Sachverhalt eigentlich klar ist oder man selbst zur Klärung (noch) gar nicht viel beitragen kann? Zwei Monate ließ sich Özil Zeit für eine Erklärung. In dieser Zeit hat sich die Öffentlichkeit längst ihre Meinung gebildet.
Dafür muss man wissen: Wer selbst nicht Stellung bezieht, über den wird Stellung bezogen – von anderen. Das gilt für Kultusminister, die sich für schlagzeilenträchtige Ereignisse in ihrem Kompetenzbereich verantworten sollen (beispielsweise den aktuellen Lehrermangel), genauso wie für Schulleitungen, die sich für so furchtbare Ereignisse wie den Tod eines Schülers oder das vermeintliche krasse Fehlverhalten eines Lehrers rechtfertigen sollen. So etwas geschieht selten, aber es passiert. Versuche, das Thema abzubürsten, gehen garantiert in die Hose. Wie sich am Beispiel von Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff zeigen lässt, der im Vorfeld der WM die Debatte um das Erdogan-Foto für beendet erklärte. Womit er sich lächerlich machte.
Kommunikation – möglichst ehrlich. Reicht schon.
Solche Versuche hat es auch immer wieder in der Bildungspolitik gegeben – etwa von Niedersachsens früherer Kultusministerin Frauke Heiligenstadt, die seinerzeit zum Abordnungschaos nur höchst widerwillig Auskunft gab. Als sie dann doch Stellung beziehen musste, stellte sie den dilettantisch verwalteten Lehrermangel als völlig normal dar. Und machte sich damit lächerlich. Zur Landtagswahl durfte sie dann gar nicht mehr für das Amt antreten. Der Vergleich mit Gündogan zeigt aber: Es ist gar nicht nötig, in Sack und Asche zu gehen. Wer sich zeitnah erklärt und damit der Öffentlichkeit zeigt, das Thema zumindest ernst zu nehmen, der wird auch ernst genommen.
Allerdings: Die Form der Erklärung spielt schon auch eine Rolle, nicht nur der Zeitpunkt. Eine geschwätzige und in entscheidenden Teilen unverständliche Deklaration herauszugeben („Ich verstehe, dass es vielleicht schwer nachzuvollziehen ist, da in einigen Kulturen ein politischer Führer nicht getrennt von der Person betrachtet werden kann. Aber in diesem Fall ist es anders.“), aber Nachfragen nicht zu beantworten, ist in keinem Fall eine gute Idee. Es geht um Kommunikation, die ist nunmal keine Einbahnstraße. Und es geht um Ehrlichkeit – die Grundlage jeder guten PR.
Andrej Priboschek leitete sieben Jahre lang die Öffentlichkeitsarbeit des Schulministeriums von Nordrhein-Westfalen. Er leitet heute die Agentur für Bildungsjournalismus, eine Kommunikationsagentur.